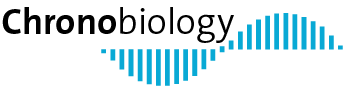Schlaf ist gesund – diese allgemeine Erkenntnis wird durch die Wissenschaft gestützt. Frühere Untersuchungen hatten bereits gezeigt, dass bei Menschen, die nach einer Impfung schliefen, die Immunantwort im Durchschnitt doppelt so stark war wie bei Menschen, die in der Nacht nach der Impfung nicht schliefen. Die zellbiologischen Gründe dafür waren jedoch bisher kaum untersucht worden. Ein Team um Professorin Luciana Besedovsky vom Institut für Medizinische Psychologie hat nun nachgewiesen, dass Schlaf das Potenzial von Immunzellen – sogenannten T-Zellen – fördert, zu Lymphknoten zu wandern. Die Forscher haben ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift „Brain, Behavior, and Immunity” veröffentlicht.
Warum Schlaf die Immunantwort unterstützt
Die Wissenschaftler untersuchten wiederholt die Konzentration verschiedener Untergruppen von T-Zellen im Blut einer Kohorte gesunder Männer und Frauen im Verlauf von zwei 24-Stunden-Sitzungen. In einer der beiden Testbedingungen durften die Teilnehmer nachts acht Stunden schlafen, während sie in der anderen nachts im Bett entspannten, aber wach blieben. Ein mit einem Schlauch mit einem Nebenraum verbundener Unterarmkatheter ermöglichte die Blutentnahme, ohne den Schlaf der Teilnehmer zu stören. Die Analyse der Blutproben ergab signifikante Unterschiede zwischen den Testbedingungen: „Unsere Ergebnisse zeigen, dass Schlaf das Migrationspotenzial verschiedener T-Zell-Subpopulationen fördert“, sagt Besedovsky.
 Wie die Forscher nachweisen konnten, verstärkt Schlaf die gezielte Migration von T-Zellen zu einem Signalprotein, dem sogenannten „Homing“-Chemokin CCL19. Dieses Molekül vermittelt die Migration von T-Zellen, die über den entsprechenden Rezeptor für CCL19 verfügen, zu den Lymphknoten, wo die T-Zell-Abwehr durch die Präsentation von Antigenen „trainiert“ wird – beispielsweise nach einer Impfung. In weiteren Experimenten zeigten die Forscher, dass die Inkubation von T-Zellen mit Blutplasma von schlafenden Probanden ebenfalls das Migrationspotenzial erhöhte. „Dies zeigt, dass lösliche Faktoren, die während des Schlafs im Blutplasma erhöht sind, die Wirkung des Schlafs auf die T-Zell-Migration vermitteln. So können wir die Wirkung des Schlafs im Labor mit dem Blutplasma von schlafenden Personen gewissermaßen nachstellen“, berichtet Besedovsky.
Wie die Forscher nachweisen konnten, verstärkt Schlaf die gezielte Migration von T-Zellen zu einem Signalprotein, dem sogenannten „Homing“-Chemokin CCL19. Dieses Molekül vermittelt die Migration von T-Zellen, die über den entsprechenden Rezeptor für CCL19 verfügen, zu den Lymphknoten, wo die T-Zell-Abwehr durch die Präsentation von Antigenen „trainiert“ wird – beispielsweise nach einer Impfung. In weiteren Experimenten zeigten die Forscher, dass die Inkubation von T-Zellen mit Blutplasma von schlafenden Probanden ebenfalls das Migrationspotenzial erhöhte. „Dies zeigt, dass lösliche Faktoren, die während des Schlafs im Blutplasma erhöht sind, die Wirkung des Schlafs auf die T-Zell-Migration vermitteln. So können wir die Wirkung des Schlafs im Labor mit dem Blutplasma von schlafenden Personen gewissermaßen nachstellen“, berichtet Besedovsky.
Die Wissenschaftler identifizierten Wachstumshormon und Prolaktin als entscheidende Faktoren für dieses Migrationsverhalten. Beide Hormone zeigten schlafabhängige Konzentrationsänderungen im Plasma, mit höheren Werten bei den Teilnehmern, die nachts geschlafen hatten. „Unsere Ergebnisse haben auch potenzielle klinische Implikationen“, sagt Besedovsky. “ So könnten Wachstumshormon und Prolaktin als neue Adjuvanzien zur Förderung der Immunantwort nach einer Impfung in Betracht gezogen werden, insbesondere bei älteren Menschen, die typischerweise während des Schlafs einen reduzierten Spiegel dieser Hormone aufweisen. Insgesamt sehen die Autoren die Studie als einen wichtigen Schritt zum besseren Verständnis, warum Schlaf die Immunantwort – beispielsweise nach einer Impfung – unterstützt und warum Impfstoffe bei älteren Menschen oft weniger wirksam sind.
Das Immunsystem zum günstigen Zeitpunkt stimulieren
Durch die Entschlüsselung der Zellmigrationsmechanismen, die der Immunantwort zugrunde liegen, haben Wissenschaftler der Universität Genf (UNIGE) in der Schweiz und der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in Deutschland gezeigt, dass die Aktivierung des Immunsystems je nach Tageszeit moduliert wird. Tatsächlich schwankt die Migration von Immunzellen von der Haut zu den Lymphknoten über einen Zeitraum von 24 Stunden. Die Immunfunktion ist in der Ruhephase am höchsten, kurz bevor die Aktivität wieder aufgenommen wird – bei Mäusen, die nachtaktive Tiere sind, am Nachmittag und beim Menschen am frühen Morgen. Diese Ergebnisse, die in der Fachzeitschrift Nature Immunology nachzulesen sind, legen nahe, dass die Tageszeit möglicherweise bei der Verabreichung von Impfstoffen oder Immuntherapien gegen Krebs berücksichtigt werden sollte, um deren Wirksamkeit zu erhöhen.
Zusätzliche Daten deuten auch darauf hin, dass bei Stimulation des Immunsystems zu verschiedenen Tageszeiten die gleichen Schwankungen auftreten, mit einem Höhepunkt am Morgen. Aber warum wird das Immunsystem von einem oszillierenden Rhythmus gesteuert? Circadiane Rhythmen fungieren als Energiesparsystem, um die Energieressourcen entsprechend den unmittelbarsten Bedürfnissen optimal zu nutzen. Könnte dies eine Möglichkeit für das Immunsystem sein, in Zeiten, in denen das Risiko einer Exposition gegenüber Krankheitserregern durch die Nahrungsaufnahme und/oder soziale Interaktionen am größten ist, in Alarmbereitschaft zu sein? Könnten wir ebenfalls abends und nachts anfälliger für Krankheitserreger sein? Das lässt sich derzeit noch nicht sagen. Nichtsdestotrotz wird die Bedeutung des zirkadianen Rhythmus für das Immunsystem gerade erst entdeckt und könnte sowohl für die präventive Impfung als auch für die Verabreichung von Antitumortherapien oder die Behandlung von Autoimmunerkrankungen von großer Bedeutung sein.