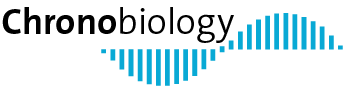Menschen, die schlecht schlafen, haben mit größerer Wahrscheinlichkeit als andere ein Gehirn, das älter erscheint, als es tatsächlich ist. Dies geht aus einer umfassenden Studie des Karolinska Institut hervor. Eine erhöhte Entzündungsaktivität im Körper könnte diesen Zusammenhang teilweise erklären.
Schlechter Schlaf wird mit Demenz in Verbindung gebracht, aber es ist unklar, ob ungesunde Schlafgewohnheiten zur Entwicklung von Demenz beitragen oder eher frühe Symptome der Krankheit sind. In einer neuen Studie haben Forscher des Karolinska-Instituts den Zusammenhang zwischen Schlafmerkmalen und dem scheinbaren Alter des Gehirns im Verhältnis zu seinem chronologischen Alter untersucht. Die Studie umfasst 27.500 Menschen mittleren Alters und ältere Menschen aus der UK Biobank, die sich einer Magnetresonanztomographie (MRT) des Gehirns unterzogen haben. Mithilfe von maschinellem Lernen schätzten die Forscher das biologische Alter des Gehirns auf der Grundlage von über tausend MRT-Phänotypen des Gehirns.
Wie Schlaf und Gehirn zusammenhängen
Das Gehirn spielt eine zentrale Rolle für den Schlaf und beeinflusst ihn auf mehreren Ebenen. Im Hypothalamus befindet sich der sogenannte suprachiasmatische Nukleus, der als innere Uhr fungiert. Er registriert Licht über die Augen und steuert auf diese Weise unseren Wach- und Schlafrhythmus, unter anderem durch die Regulierung von Hormonen wie Melatonin, das Müdigkeit fördert. Gleichzeitig sammelt sich während des Wachzustands das Molekül Adenosin im Gehirn an, was den sogenannten Schlafdruck erzeugt: Je mehr Adenosin vorhanden ist, desto stärker wird das Bedürfnis zu schlafen. Das retikuläre Aktivierungssystem im Hirnstamm hält uns wach, während der VLPO-Kern im Hypothalamus den Schlaf einleitet. Verschiedene Neurotransmitter spielen dabei eine Rolle: GABA fördert Entspannung und Schlaf, Serotonin unterstützt den Schlaf-Wach-Rhythmus, und Orexin hält uns wach – eine Fehlfunktion kann zu Narkolepsie führen.
 Schlaf wirkt zugleich stark auf das Gehirn zurück. Während des Schlafs verarbeitet das Gehirn Informationen, wodurch Lernen und Gedächtnis unterstützt werden: Im REM-Schlaf werden kreative Ideen und emotionale Erfahrungen integriert, während im Tiefschlaf Fakten, Vokabeln oder motorische Fähigkeiten gefestigt werden. Außerdem wird im Tiefschlaf das glymphatische System aktiv, das Abfallstoffe wie Beta-Amyloid aus dem Gehirn transportiert, was dem Schutz vor neurodegenerativen Erkrankungen dient. Schlaf hilft zudem, Emotionen zu regulieren, Ängste zu reduzieren und die Impulskontrolle zu verbessern, während gleichzeitig Synapsen „resetet“ und Nervenzellverbindungen gestärkt werden. Ein ausreichender und erholsamer Schlaf führt daher zu besserer Konzentration, schnellerer Reaktionsfähigkeit und erhöhter Leistungsfähigkeit.
Schlaf wirkt zugleich stark auf das Gehirn zurück. Während des Schlafs verarbeitet das Gehirn Informationen, wodurch Lernen und Gedächtnis unterstützt werden: Im REM-Schlaf werden kreative Ideen und emotionale Erfahrungen integriert, während im Tiefschlaf Fakten, Vokabeln oder motorische Fähigkeiten gefestigt werden. Außerdem wird im Tiefschlaf das glymphatische System aktiv, das Abfallstoffe wie Beta-Amyloid aus dem Gehirn transportiert, was dem Schutz vor neurodegenerativen Erkrankungen dient. Schlaf hilft zudem, Emotionen zu regulieren, Ängste zu reduzieren und die Impulskontrolle zu verbessern, während gleichzeitig Synapsen „resetet“ und Nervenzellverbindungen gestärkt werden. Ein ausreichender und erholsamer Schlaf führt daher zu besserer Konzentration, schnellerer Reaktionsfähigkeit und erhöhter Leistungsfähigkeit.
Schlechter Schlaf kann das Gehirn auf vielfältige und teilweise tiefgreifende Weise beeinträchtigen. Wenn wir regelmäßig nicht ausreichend oder qualitativ schlechten Schlaf bekommen, gerät das empfindliche Gleichgewicht der Gehirnfunktionen aus dem Lot. Zunächst leidet das Gedächtnis und die Lernfähigkeit. Im Schlaf werden Informationen verarbeitet und im Langzeitgedächtnis abgespeichert: Fakten und motorische Fähigkeiten im Tiefschlaf, emotionale Erfahrungen und kreative Ideen im REM-Schlaf. Fehlt dieser Schlaf, können neue Informationen schlechter behalten werden, und bestehende Erinnerungen lassen sich schwerer abrufen.
Auch die emotionale Regulation wird gestört. Chronischer Schlafmangel erhöht die Reizbarkeit, Angstgefühle und depressive Symptome, weil das Gehirn weniger gut in der Lage ist, Emotionen zu verarbeiten und Stressreaktionen zu dämpfen. Darüber hinaus leidet die kognitive Leistungsfähigkeit: Konzentration, Aufmerksamkeit, Problemlösungsfähigkeit und Reaktionszeit nehmen ab. Das Gehirn arbeitet weniger effizient, und Entscheidungen fallen impulsiver oder fehleranfälliger aus. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die „Reinigung“ des Gehirns über das glymphatische System. Im Tiefschlaf werden Abfallstoffe wie Beta-Amyloid und Tau-Proteine abtransportiert. Bei dauerhaft schlechtem Schlaf häufen sich diese Stoffe an, was das Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer erhöhen kann. Schlechter Schlaf beeinflusst zudem Hirnstrukturen selbst: Studien zeigen, dass chronischer Schlafmangel mit Veränderungen in Bereichen wie dem Hippocampus (für Gedächtnis) und dem präfrontalen Cortex (für Entscheidungsfindung und Impulskontrolle) verbunden ist.
Leichte Entzündung
Die Schlafqualität der Teilnehmer in der Studie wurde anhand von fünf selbst angegebenen Faktoren bewertet: Chronotyp (Morgen- oder Abendmensch), Schlafdauer, Schlaflosigkeit, Schnarchen und Tagesmüdigkeit. Anschließend wurden sie in drei Gruppen eingeteilt: gesunder (≥4 Punkte), mittlerer (2-3 Punkte) oder schlechter (≤1 Punkt) Schlaf.„Die Differenz zwischen dem Gehirnalter und dem chronologischen Alter vergrößerte sich um etwa sechs Monate pro 1 Punkt Abnahme des gesunden Schlafwertes“, erklärt Abigail Dove, Forscherin am Institut für Neurobiologie, Pflegewissenschaften und Gesellschaft des Karolinska-Instituts, die die Studie leitete. „Menschen mit schlechtem Schlaf hatten Gehirne, die im Durchschnitt ein Jahr älter waren als ihr tatsächliches Alter.“

Andere mögliche Mechanismen, die den Zusammenhang erklären könnten, sind negative Auswirkungen auf das Abfallbeseitigungssystem des Gehirns, das hauptsächlich während des Schlafs aktiv ist, oder dass schlechter Schlaf die Herz-Kreislauf-Gesundheit beeinträchtigt, was sich wiederum negativ auf das Gehirn auswirken kann. Die Teilnehmer der UK Biobank sind gesünder als die allgemeine britische Bevölkerung, was die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse einschränken könnte. Eine weitere Einschränkung der Studie besteht darin, dass die Ergebnisse auf selbst berichteten Schlafdaten basieren. Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit Forschern der Schwedischen Hochschule für Sport und Gesundheitswissenschaften sowie der Tianjin Medical University und der Sichuan University in China durchgeführt.
Risikofaktoren für eine vorzeitige Alterung des Gehirns
Durch die Schätzung des Gehirnalter von Menschen anhand von MRT-Scans unter Verwendung von maschinellem Lernen hat ein Team unter der Leitung von Forschern der UCL mehrere Risikofaktoren für eine vorzeitige Alterung des Gehirns identifiziert. Sie fanden heraus, dass eine schlechtere kardiovaskuläre Gesundheit im Alter von 36 Jahren ein höheres Gehirnalter im späteren Leben vorhersagte, während Männer tendenziell auch ältere Gehirne hatten als Frauen im gleichen Alter, wie sie in The Lancet Healthy Longevity berichten.
Ein höheres Gehirnalter war mit etwas schlechteren Ergebnissen bei kognitiven Tests verbunden und sagte auch eine verstärkte Schrumpfung des Gehirns (Atrophie) in den folgenden zwei Jahren voraus, was darauf hindeutet, dass es ein wichtiger klinischer Marker für Menschen sein könnte, die einem Risiko für kognitiven Verfall oder andere Erkrankungen des Gehirns ausgesetzt sind. Der Hauptautor Professor Jonathan Schott (UCL Dementia Research Centre, UCL Queen Square Institute of Neurology) sagte: „Wir haben festgestellt, dass trotz des sehr ähnlichen tatsächlichen Alters aller Personen in dieser Studie sehr große Unterschiede darin bestanden, wie alt das Computermodell ihr Gehirn einschätzte. Wir hoffen, dass diese Technik eines Tages ein nützliches Instrument zur Identifizierung von Personen sein könnte, die einem Risiko für beschleunigtes Altern ausgesetzt sind, damit ihnen frühzeitig gezielte Präventionsstrategien zur Verbesserung ihrer Gehirngesundheit angeboten werden können.“Die Forscher wandten ein etabliertes, auf MRT basierendes maschinelles Lernmodell an, um das Gehirnalter der Teilnehmer der von Alzheimer’s Research UK finanzierten Insight-46-Studie unter der Leitung von Professor Schott zu schätzen. Die Teilnehmer der Insight-46-Studie stammen aus der britischen Geburtskohorte 1946 der National Survey of Health and Development (NSHD) des Medical Research Council. Da die Teilnehmer ihr ganzes Leben lang an der Studie teilgenommen hatten, konnten die Forscher ihr aktuelles Gehirnalter mit verschiedenen Faktoren aus ihrem gesamten Lebensverlauf vergleichen. Die Teilnehmer waren alle zwischen 69 und 72 Jahre alt, aber ihr geschätztes Gehirnalter reichte von 46 bis 93 Jahren.

Die Forscher fanden außerdem heraus, dass ein höheres Gehirnalter mit einer höheren Konzentration des Neurofilament-Light-Proteins (NfL) im Blut verbunden war. Ein erhöhter NfL-Spiegel entsteht vermutlich aufgrund von Nervenschäden und wird zunehmend als nützlicher Marker für Neurodegeneration anerkannt. Dr. Sara Imarisio, Forschungsleiterin bei Alzheimer’s Research UK, sagte: „Die Insight 46-Studie trägt dazu bei, mehr über die komplexen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Faktoren zu erfahren, die die Gehirngesundheit von Menschen im Laufe ihres Lebens beeinflussen. Mithilfe von maschinellem Lernen haben die Forscher dieser Studie weitere Belege dafür gefunden, dass eine schlechtere Herzgesundheit in der Lebensmitte mit einer stärkeren Schrumpfung des Gehirns im späteren Leben verbunden ist.“
Weitere negative Faktoren
Die vorzeitige Alterung des Gehirns kann auch durch andere Risikofaktoren begünstigt werden, die sich meist gegenseitig verstärken, z.b. spielt die Ernährung eine entscheidende Rolle: Ein hoher Zucker- und Fettkonsum, Mangel an Omega-3-Fettsäuren, Vitaminen oder Antioxidantien kann Entzündungen im Gehirn fördern und die Neuroplastizität verringern. Bewegungsmangel wirkt ebenfalls schädlich, da körperliche Aktivität die Durchblutung des Gehirns verbessert, das Wachstum neuer Nervenzellen anregt und kognitive Funktionen stärkt.
Chronischer Stress und anhaltende psychische Belastungen führen zu einer Überproduktion von Cortisol, das besonders empfindliche Hirnregionen wie den Hippocampus und den präfrontalen Cortex schädigen kann, wodurch Gedächtnis, Lernfähigkeit und emotionale Regulation beeinträchtigt werden. Zudem erhöhen Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum und andere Drogen die neuronale Toxizität und fördern Entzündungen, was das Risiko für kognitive Einbußen und neurodegenerative Erkrankungen steigert.Auch soziale Faktoren und geistige Unterforderung spielen eine Rolle: Wer wenige soziale Kontakte hat oder geistig kaum gefordert wird, bietet dem Gehirn weniger Stimulation, was die kognitive Leistungsfähigkeit verringern kann. Schließlich tragen Umweltfaktoren wie Luftverschmutzung oder chronische Belastung durch Schwermetalle und toxische Chemikalien zu Entzündungen und Schädigungen im Gehirn bei.