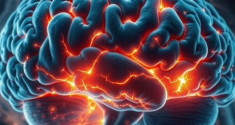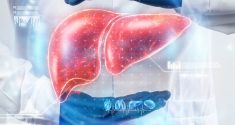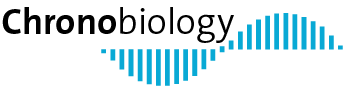Man könnte meinen, dass man im Sommer gesünder ist. Die Sonne scheint, wir bekommen viel Vitamin D und die Tage sind lang. Forschungsergebnisse der Universität Kopenhagen deuten jedoch darauf hin, dass die Ernährungsgewohnheiten im Winter besser für unsere Stoffwechselgesundheit sind als die Ernährungsgewohnheiten im Sommer, zumindest wenn man eine Maus ist.
Forscher haben den Stoffwechsel und das Gewicht von Mäusen untersucht, die sowohl „Winterlicht” als auch „Sommerlicht” ausgesetzt waren. „Wir haben festgestellt, dass selbst bei nicht saisonalen Tieren Unterschiede in den Lichtstunden zwischen Sommer und Winter zu Unterschieden im Energiestoffwechsel führen. In diesem Fall sind das Körpergewicht, Fettmasse und Leberfettgehalt”, sagt Lewin Small, der die Forschung als Postdoktorand am Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research an der Universität Kopenhagen durchgeführt hat. Er fügt hinzu: „Wir haben dies vor allem bei Mäusen festgestellt, die den Lichtverhältnissen im Winter ausgesetzt waren. Diese Mäuse nahmen weniger an Körpergewicht zu und wiesen eine geringere Fettleibigkeit auf. Sie ernährten sich über einen Zeitraum von 24 Stunden rhythmischer. Dies führte dann zu Vorteilen für die Stoffwechselgesundheit.“ Die Studie ist die erste ihrer Art, die den Einfluss der Tageslichtstunden auf den Stoffwechsel von Mäusen untersuchte, die nicht als saisonale Tiere gelten, da sie wie Menschen nicht nur in bestimmten Jahreszeiten brüten. Tiere, die in bestimmten Jahreszeiten brüten, nehmen vor der Brutzeit an Gewicht zu, um Energievorräte zu sparen.
Tageslichtstunden beeinflussen den Stoffwechsel
Tageslicht spielt eine zentrale Rolle für den menschlichen Stoffwechsel, weil es den inneren Biorhythmus maßgeblich steuert. Wenn Licht auf die Augen trifft, sendet der Körper Signale an die innere Uhr im Gehirn, die daraufhin verschiedene Hormone reguliert. Besonders am Morgen sorgt helles Tageslicht dafür, dass die Produktion des Schlafhormons Melatonin gedrosselt wird. Gleichzeitig steigt der Cortisolspiegel auf natürliche Weise an, was den Körper wach und aktiv macht und den Energieumsatz anregt. Ein gut abgestimmter Licht- und Hormonrhythmus hilft dem Stoffwechsel, gleichmäßig zu arbeiten, die Blutzuckerregulation zu unterstützen und die Fettverbrennung auf Kurs zu halten. Zu wenig Tageslicht, wie es im Winter oder bei langen Aufenthalten in Innenräumen häufig vorkommt, kann diesen Ablauf stören. Der Körper bleibt länger in einer Art Ruhemodus, Müdigkeit nimmt zu und der Stoffwechsel läuft langsamer.

Unterschiede in der Lichtintensität zwischen Sommer und Winter könnten unsere Essgewohnheiten beeinflussen
Die Inspiration für die Studie kam den Forschern aufgrund der erheblichen Unterschiede in den Tageslichtstunden in verschiedenen Regionen der Welt. „Wir untersuchen den Einfluss der Tageszeit auf Aspekte des Stoffwechsels wie Bewegung, Fettleibigkeit und Diabetes. Die meisten Studien, die diesen Zusammenhang untersuchen, gehen jedoch von einer ganzjährig gleichen Länge von Tag und Nacht aus“, sagt Lewin Small. Daher wollten sie herausfinden, was die saisonalen Lichtunterschiede für den Stoffwechsel bedeuten. Die meisten Menschen auf der Welt leben mit einem Lichtunterschied von mindestens zwei Stunden zwischen Sommer und Winter. „Ich komme aus Australien, und als ich nach Dänemark zog, war ich an den großen Unterschied zwischen Sommer und Winter nicht gewöhnt und interessierte mich dafür, wie sich dies auf den Tagesrhythmus und den Stoffwechsel auswirken könnte“, sagt Lewin Small und fügt hinzu: „Deshalb setzten wir Labormäuse unterschiedlichen Lichtverhältnissen aus, die verschiedene Jahreszeiten repräsentierten, und maßen die Marker für die Stoffwechselgesundheit und den Tagesrhythmus dieser Tiere.“
Da die Forschung mit Mäusen als Versuchstieren durchgeführt wurde, kann man nicht davon ausgehen, dass das Gleiche auch für Menschen gilt. „Dies ist ein Beweis für das Prinzip. Beeinflussen Unterschiede in den Lichtstunden den Energiestoffwechsel? Ja, das tun sie. Weitere Studien am Menschen könnten zeigen, dass eine Veränderung unserer Exposition gegenüber künstlichem Licht in der Nacht oder natürlichem Licht im Laufe des Jahres zur Verbesserung unserer Stoffwechselgesundheit genutzt werden könnte“, sagt Juleen Zierath, Professorin am Novo Nordisk Center for Basic Metabolism Research (CBMR) und leitende Autorin der Studie. Lewin Small fügt hinzu, dass diese neuen Erkenntnisse wichtig sind, um zu verstehen, wie Essgewohnheiten durch Licht und Jahreszeiten beeinflusst werden, was uns helfen könnte zu verstehen, warum manche Menschen mehr Gewicht zunehmen oder ob Menschen zu einer bestimmten Jahreszeit mehr Gewicht zunehmen. Unterschiede in der Lichtintensität zwischen Sommer und Winter könnten unsere Hungerempfindungen beeinflussen und wann wir tagsüber Hunger bekommen.
Was und wie viel wir essen, kann unsere innere Uhr und unsere Hormonreaktionen verändern
Frühere Forschungen haben gezeigt, dass Glukokortikoidhormone wie Cortisol den Zucker- und Fettspiegel im Laufe von 24 Stunden unterschiedlich steuern, je nach Tages- und Nachtzeit, Nahrungsaufnahme und Fasten, Ruhe und Aktivität. Eine an Mäusen durchgeführte Untersuchung ergab, dass der tageszeitabhängige Stoffwechselzyklus durch eine kalorienreiche Ernährung verändert wird. Da Glukokortikoide häufig zur Behandlung von Entzündungskrankheiten eingesetzt werden, deuten diese in Molecular Cell veröffentlichten Ergebnisse darauf hin, dass schlanke und adipöse Patienten unterschiedlich auf eine Steroidtherapie reagieren könnten. Schließlich werden die biologische Funktion des täglichen Rhythmus der Hormonausschüttung (hoch vor dem Aufwachen und Essen, niedrig während des Schlafens und Fastens) sowie die täglichen Zyklen der Zucker- und Fettspeicherung oder -freisetzung durch die Leber aufgezeigt.
Jede Zelle im menschlichen Körper wird von einer inneren Uhr gesteuert, die dem 24-Stunden-Tagesrhythmus folgt. Sie wird hauptsächlich durch das Sonnenlicht, aber auch durch soziale Gewohnheiten mit dem natürlichen Tag-Nacht-Zyklus synchronisiert. In einem gesunden System werden jeden Morgen Glukokortikoid-Stresshormone von der Nebenniere produziert. Die Ausschüttung von Glukokortikoiden erreicht vor dem Aufwachen ihren Höhepunkt und veranlasst den Körper, Fettsäuren und Zucker als Energiequellen zu nutzen, sodass wir unsere täglichen Aktivitäten beginnen können. Wenn der circadiane Rhythmus gestört ist (z. B. durch Schichtarbeit oder Jetlag) und/oder wenn sich der Glukokortikoidspiegel verändert (z. B. durch das Cushing-Syndrom oder eine langfristige klinische Anwendung), kann dies zu tiefgreifenden Stoffwechselstörungen führen – wie Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes und Fettlebererkrankungen. Das Ziel der Forscher war es daher, die Bedeutung dieser täglichen Spitzen der Stresshormonausschüttung, den Einfluss dieser Hormone auf unsere „innere Uhr” und ihre Rolle für die täglichen Stoffwechselzyklen zu verstehen.
Stoffwechselwirkungen von Glukokortikoiden in der Leber
Um die Stoffwechselwirkungen von Glukokortikoiden in der Leber zu untersuchen, charakterisierten die Forscher die Aktivität ihres Rezeptors, des sogenannten Glukokortikoidrezeptors, mithilfe neuartiger Hochdurchsatztechniken. Sie analysierten die Lebern von Mäusen alle vier Stunden während des Tages und der Nacht. Die Mäuse befanden sich entweder in einem normalen Zustand oder wurden mit einer fettreichen Ernährung gefüttert. Anschließend verwendeten sie modernste Technologien aus den Bereichen Genomik, Proteomik und Bioinformatik, um darzustellen, wann und wo der Glukokortikoidrezeptor seine metabolischen Wirkungen entfaltet. Die Forscher untersuchten die Auswirkungen der täglichen Ausschüttungsschübe von Glukokortikoiden im 24-Stunden-Zyklus des Leberstoffwechsels. Sie konnten zeigen, wie Glukokortikoide den Stoffwechsel während des Fastens (wenn die Mäuse schlafen) und während der Fütterung (wenn sie aktiv sind) durch zeitabhängige Bindung an das Genom unterschiedlich regulieren. Darüber hinaus zeigten sie, wie der Großteil der rhythmischen Genaktivität durch diese Hormone gesteuert wird. Wenn diese Kontrolle verloren geht (bei sogenannten Knockout-Mäusen), sind die Zucker- und Fettwerte im Blut beeinträchtigt. Dies erklärt, warum die Leber die Zucker- und Fettwerte im Blut tagsüber und nachts unterschiedlich reguliert.
Da der Glukokortikoidrezeptor ein häufig verwendetes Zielmolekül in der Immuntherapie ist, untersuchten sie in einem nächsten Schritt seine genomischen Auswirkungen nach der Injektion des Medikaments Dexamethason, einem synthetischen Glukokortikoid, das ebenfalls diesen Rezeptor aktiviert. „Mit diesem Experiment“, erklärt Dr. Fabiana Quagliarini, „haben wir festgestellt, dass die Reaktion auf das Medikament bei fettleibigen Mäusen anders war als bei schlanken Mäusen. Es ist das erste Mal, dass gezeigt wurde, dass die Ernährung die hormonellen und medikamentösen Reaktionen von Stoffwechselgeweben verändern kann.“
 Wichtige Erkenntnisse für die Chronomedizin und die Therapie von Stoffwechselerkrankungen
Wichtige Erkenntnisse für die Chronomedizin und die Therapie von Stoffwechselerkrankungen
Glukokortikoide sind eine Gruppe natürlicher und synthetischer Steroidhormone wie beispielsweise Cortisol, die im Körper vor allem in der Nebennierenrinde produziert werden. Sie folgen im Körper einem strengen Tagesrhythmus. Morgens ist der Cortisolspiegel am höchsten, um den Körper zu aktivieren, und fällt im Laufe des Tages ab. Dieser Rhythmus wird über die innere Uhr gesteuert und kann durch Licht, Stress oder Schlafverhalten beeinflusst werden. Glukokortikoide verfügen über starke entzündungshemmende und immunsuppressive Eigenschaften, mit denen sich die Aktivität des Immunsystems steuern lässt. Aus diesem Grund finden sie in der Medizin breite Anwendung. Der größte Nachteil ist, dass Glukokortikoide aufgrund ihrer Fähigkeit, den Zucker- und Fettstoffwechsel zu modulieren, auch schwerwiegende Nebenwirkungen verursachen: Patienten können an Fettleibigkeit, Hypertriglyceridämie, Fettleber, Bluthochdruck oder Typ-2-Diabetes erkranken.
„Das Verständnis, wie Glukokortikoide den 24-Stunden-Zyklus der Genaktivität in der Leber und damit den Zucker- und Fettspiegel im Blut steuern, liefert neue Erkenntnisse für die Chronomedizin und die Entwicklung von Stoffwechselerkrankungen. Wir konnten einen neuen Zusammenhang zwischen Lebensstil, Hormonen und Physiologie auf molekularer Ebene beschreiben, der darauf hindeutet, dass übergewichtige Menschen möglicherweise anders auf die tägliche Hormonausschüttung oder auf Glukokortikoid-Medikamente reagieren. Diese Mechanismen bilden die Grundlage für die Entwicklung zukünftiger Therapieansätze“, betont Prof. Henriette Uhlenhaut.