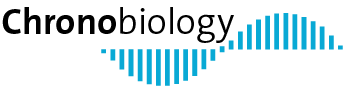Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Menschen, die sich nicht wegen obstruktiver Schlafapnoe behandeln lassen, ein höheres Risiko haben, an Parkinson zu erkranken. Die Verwendung von kontinuierlichem positivem Atemwegsdruck (CPAP) kann dieses Risiko verringern, indem die Schlafqualität verbessert und ein konstanter Luftstrom während der Nacht aufrechterhalten wird. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift JAMA Neurology veröffentlicht und analysierte die elektronischen Gesundheitsdaten von mehr als 11 Millionen US-Militärveteranen, die zwischen 1999 und 2022 vom Department of Veterans Affairs behandelt wurden. Forscher der Oregon Health & Science University und des Portland VA Health Care System leiteten das Projekt.
Was ist die Parkinson-Krankheit?
Die Parkinson-Krankheit ist eine fortschreitende neurologische Störung, bei der bestimmte Nervenzellen im Gehirn, insbesondere in der Substantia nigra, allmählich absterben. Diese Nervenzellen produzieren normalerweise Dopamin, einen Neurotransmitter, der für die Steuerung von Bewegungen und die Interaktion zwischen Muskeln und Nerven entscheidend ist. Wenn der Dopaminspiegel sinkt, kommt es zu den typischen Bewegungsstörungen, die die Krankheit kennzeichnen.
 Die Parkinson-Krankheit ist weltweit eine der häufigsten neurodegenerativen Erkrankungen. Besonders betroffen sind Menschen ab 60 Jahren, wobei das Risiko mit zunehmendem Alter steigt. Schätzungen zufolge erkranken ein bis zwei von 1.000 Menschen in der Allgemeinbevölkerung, bei den über 60-Jährigen sind es sogar ein bis zwei von 100. Männer sind etwas häufiger betroffen als Frauen. Obwohl die Parkinson-Krankheit meist bei älteren Menschen auftritt, kann sie in seltenen Fällen auch jüngere Erwachsene betreffen.
Die Parkinson-Krankheit ist weltweit eine der häufigsten neurodegenerativen Erkrankungen. Besonders betroffen sind Menschen ab 60 Jahren, wobei das Risiko mit zunehmendem Alter steigt. Schätzungen zufolge erkranken ein bis zwei von 1.000 Menschen in der Allgemeinbevölkerung, bei den über 60-Jährigen sind es sogar ein bis zwei von 100. Männer sind etwas häufiger betroffen als Frauen. Obwohl die Parkinson-Krankheit meist bei älteren Menschen auftritt, kann sie in seltenen Fällen auch jüngere Erwachsene betreffen.
Die Ursachen der Parkinson-Krankheit sind noch immer nicht vollständig geklärt, aber es ist bekannt, dass mehrere Faktoren zusammenwirken. Im Mittelpunkt der Krankheit steht das fortschreitende Absterben von Dopamin produzierenden Nervenzellen in der Substantia nigra, einem Bereich des Gehirns, der für die Steuerung von Bewegungen wichtig ist. Es ist nicht klar, warum diese Zellen absterben. Sowohl genetische als auch umweltbedingte Faktoren können eine Rolle spielen. Etwa 5-10 Prozent der Fälle lassen sich auf genetische Veränderungen zurückführen, beispielsweise auf Mutationen in bestimmten Genen wie LRRK2, PINK1 oder SNCA. In den meisten Fällen handelt es sich jedoch nicht um eine eindeutig vererbbare Form der Parkinson-Krankheit, sondern eher um eine erhöhte Anfälligkeit. Auch Umweltfaktoren stehen im Verdacht, das Risiko zu erhöhen. Dazu gehören die langfristige Exposition gegenüber Pestiziden und bestimmten Chemikalien, wie sie in der Landwirtschaft vorkommen. Auch Kopfverletzungen, Schwermetalle und Lösungsmittel werden als mögliche Risikofaktoren diskutiert. Allerdings führt keiner dieser Faktoren allein zwangsläufig zur Erkrankung, vielmehr scheint das Zusammenspiel verschiedener Einflüsse entscheidend zu sein.
Die Parkinson-Krankheit ist unheilbar
Ein weiterer wichtiger Risikofaktor ist das Alter. Je älter ein Mensch wird, desto anfälliger scheinen die Nervenzellen für Schäden zu sein, da die Selbstreparaturmechanismen des Körpers mit der Zeit nachlassen. Darüber hinaus spielen biologische Prozesse eine Rolle, wie die Fehlfaltung bestimmter Proteine wie Alpha-Synuclein. Diese können sich in den Nervenzellen ablagern und so genannte Lewy-Körperchen bilden, die die Zellfunktion stören. Oxidativer Stress, d. h. die Anhäufung schädlicher freier Radikale, sowie chronische Entzündungsprozesse im Gehirn scheinen ebenfalls zur Schädigung der Nervenzellen beizutragen. Insgesamt geht man davon aus, dass die Parkinson-Krankheit durch ein komplexes Zusammenspiel verschiedener genetischer, biologischer und umweltbedingter Faktoren verursacht wird, deren genaue Bedeutung von den Forschern noch intensiv untersucht wird.
Die Anzeichen der Krankheit entwickeln sich in der Regel schleichend und werden anfangs oft übersehen. Zu den klassischen Hauptsymptomen gehören Zittern (Schütteln) in Ruhe, Muskelsteifigkeit (Rigidität), verlangsamte Bewegungen (Bradykinesie) und Haltungsinstabilität. Viele Menschen mit Morbus Parkinson bemerken auch einen veränderten Gesichtsausdruck, kürzere Schritte beim Gehen oder Schwierigkeiten, Bewegungen zu initiieren. Neben diesen motorischen Symptomen treten häufig auch nicht-motorische Symptome wie Schlafstörungen, depressive Verstimmungen, Geruchsverlust oder autonome Probleme wie Verstopfung auf, manchmal sogar Jahre vor dem Auftreten der motorischen Symptome.
Die Behandlung der Parkinson-Krankheit zielt darauf ab, die Symptome zu lindern und die Lebensqualität so lange wie möglich zu erhalten, da die Krankheit derzeit nicht heilbar ist. Im Mittelpunkt der Therapie steht die medikamentöse Behandlung, insbesondere mit L-Dopa, das im Gehirn in Dopamin umgewandelt wird und die fehlende Dopaminproduktion teilweise ausgleicht. Andere Medikamente wie Dopamin-Agonisten oder MAO-B-Hemmer können ergänzend eingesetzt werden. Bei fortgeschrittener Parkinson-Krankheit oder wenn die Medikamente nicht ausreichend wirksam sind, kann auch eine tiefe Hirnstimulation (DBS) in Betracht gezogen werden – ein chirurgischer Eingriff, bei dem feine Elektroden bestimmte Hirnregionen stimulieren und so die Symptome verbessern. Darüber hinaus spielen nichtmedikamentöse Maßnahmen eine wichtige Rolle: Physiotherapie fördert die Mobilität und das Gleichgewicht, Logopädie hilft bei Sprach- und Schluckstörungen, und Ergotherapie erleichtert den Alltag. Auch psychologische Beratung und soziale Unterstützung können wertvoll sein.
Wie sich Schlafapnoe auf das Gehirn auswirkt
Die neue Studie legt nahe, dass eine langfristige unbehandelte Schlafapnoe zu einem höheren Parkinson-Risiko beitragen kann. Selbst nach Berücksichtigung wichtiger Faktoren wie Fettleibigkeit, Alter und Bluthochdruck fanden die Forscher immer noch einen klaren Zusammenhang zwischen unbehandelter Schlafapnoe und der Parkinson-Krankheit. Unter den Millionen von Veteranen mit Schlafapnoe hatten diejenigen, die keine CPAP-Therapie erhielten, ein fast doppelt so hohes Risiko, an Parkinson zu erkranken, wie diejenigen, die diese Therapie erhielten. „Das bedeutet nicht, dass man garantiert an Parkinson erkrankt, aber das Risiko ist deutlich erhöht“, sagte Co-Autor Gregory Scott, M.D., Ph.D., Assistenzprofessor für Pathologie an der OHSU School of Medicine und Pathologe am VA Portland.
Schlafapnoe ist eine schlafbezogene Atmungsstörung, bei der die Atmung während des Schlafs wiederholt aussetzt. Diese Atemaussetzer treten entweder auf, weil die Atemwege vorübergehend blockiert sind(obstruktive Schlafapnoe, OSA) oder weil das Gehirn vorübergehend keine Signale zum Atmen sendet (zentrale Schlafapnoe, CSA). Die obstruktive Form ist die häufigste. Durch die Atempausen sinkt der Sauerstoffgehalt im Blut, und der Körper reagiert mit kurzen Weckreaktionen, die den Schlaf immer wieder unterbrechen – oft ohne dass der Betroffene es merkt. Typische Symptome sind lautes, unregelmäßiges Schnarchen, beobachtete Atemaussetzer, Tagesmüdigkeit, Konzentrationsprobleme, morgendliche Kopfschmerzen oder ein trockener Mund nach dem Aufwachen. Unbehandelt kann die Schlafapnoe das langfristige Risiko für Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Schlaganfall und Stoffwechselerkrankungen erhöhen.
Schlafapnoe ist relativ weit verbreitet. Von obstruktiver Schlafapnoe sind schätzungsweise 5-10 % der Erwachsenen betroffen, wobei die Häufigkeit mit dem Alter zunimmt und Männer etwas häufiger betroffen sind als Frauen. Bei übergewichtigen Menschen ist das Risiko weiter erhöht. Die zentrale Schlafapnoe ist wesentlich seltener und tritt oft in Verbindung mit bestimmten Vorerkrankungen wie Herzinsuffizienz oder neurologischen Störungen auf. Die Atemaussetzer selbst können je nach Schweregrad einige Sekunden bis zu einer Minute dauern und treten meist mehrmals pro Stunde auf. Leichte Formen können etwa 5-15 Atempausen pro Stunde umfassen, mittelschwere Formen 15-30 und schwere Formen sogar mehr als 30 Atempausen pro Stunde Schlaf. Diese wiederholten Unterbrechungen erklären, warum die Betroffenen oft erschöpft sind, obwohl sie vermeintlich genug Schlaf bekommen.
Veteranen berichten von erheblichen Vorteilen durch CPAP
„Wenn Sie aufhören zu atmen und Ihr Sauerstoffgehalt nicht auf einem normalen Niveau ist, funktionieren Ihre Neuronen wahrscheinlich auch nicht auf einem normalen Niveau“, sagte der Hauptautor Lee Neilson, M.D., Assistenzprofessor für Neurologie an der OHSU und Neurologe am Portland VA. „Wenn man das Nacht für Nacht und Jahr für Jahr zusammenzählt, könnte das erklären, warum die Behebung des Problems mit CPAP eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen neurodegenerative Krankheiten, einschließlich Parkinson, aufbauen kann.“
Neilson sagte, dass die Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, der Schlafgesundheit seiner Patienten Priorität einzuräumen, insbesondere angesichts des in der Studie hervorgehobenen erhöhten Risikos für die Parkinson-Krankheit. Scott wies darauf hin, dass manche Menschen mit Schlafapnoe CPAP nur ungern verwenden, betonte jedoch, dass viele Veteranen sehr positive Erfahrungen mit dem Gerät gemacht haben. „Die Veteranen, die ihr CPAP-Gerät benutzen, lieben es“, erklärte er. „Sie erzählen anderen Menschen davon. Sie fühlen sich besser, sie sind weniger müde. Wenn andere von dieser Verringerung des Parkinson-Risikos erfahren, kann das Menschen mit Schlafapnoe davon überzeugen, CPAP noch mehr auszuprobieren.“
Ein veränderter zirkadianer Rhythmus verschlimmert die Parkinson-Krankheit
Chronischer Schlafmangel und unregelmäßige Schlaf-Wach-Zyklen können Risikofaktoren für die Parkinson-Krankheit sein, so eine Studie der Lewis Katz School of Medicine an der Temple University (LKSOM). Anhand eines Tiermodells zeigten die Forscher, dass Störungen des zirkadianen Rhythmus, die bereits vor dem Ausbruch der Parkinson-Krankheit bestehen, die durch die Krankheit verursachten motorischen und lernbezogenen Beeinträchtigungen dramatisch verschlimmern. Nach dem 60. Lebensjahr sind die meisten Fälle von Parkinson idiopathisch, d. h. ihre Ursache ist unbekannt. Einige Experten gehen davon aus, dass die Krankheit in diesen Fällen durch das Zusammenspiel von Genen und umweltbedingten Risikofaktoren entsteht. Zu letzteren gehören chronischer Stress, Schlafstörungen und Störungen des zirkadianen Rhythmus, die alle die Funktion des zentralen Nervensystems beeinträchtigen und zu der für die Parkinson-Krankheit charakteristischen Pathologie beitragen können.

Um zu verstehen, warum die Störung des zirkadianen Rhythmus die Parkinson-Krankheit verschlimmert, untersuchten die Forscher die Gehirne der betroffenen Mäuse. In einer Region, die als Substantia nigra bekannt ist, beobachteten sie einen erheblichen Rückgang der Neuronen, die Dopamin produzieren, dessen Verlust ein wichtiges molekulares Merkmal der Parkinson-Krankheit ist. Die Substantia nigra ist das Epizentrum der Parkinson-Krankheit. Normalerweise sterben die Zellen in dieser Hirnregion ab, aber unsere Studie zeigt, dass Störungen des zirkadianen Rhythmus den Zelltod dort beschleunigen. Außerdem waren die als Mikroglia bekannten Zellen, die normalerweise die Neuronen schützen, bei MPTP-behandelten Mäusen mit gestörten zirkadianen Rhythmen überaktiv. Eine Überaktivierung der Mikroglia könnte die Neuroinflammation verstärken und möglicherweise das Fortschreiten der Parkinson-Krankheit beschleunigen.